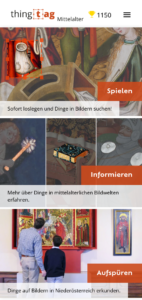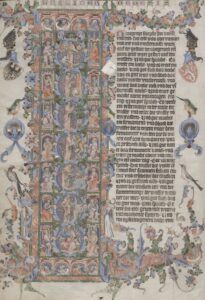Digital Humanities Infrastructure Austria
| Projektleitung | Georg Vogeler (Graz) |
| Projektmitarbeiter:innen | Christina Antenhofer (Salzburg); Alan van Beek (Salzburg); Karoline Döring (Salzburg); Peter Färberböck (Salzburg/Krems); Julia Hintersteiner (Salzburg); Isabella Nicka (Salzburg/Krems); Martin Schäler (Salzburg); Lina Maria Zangerl (Salzburg); Katharina Zeppezauer-Wachauer (Salzburg) |
| Zuordnung | Geschichte, Germanistik, Informatik, Kunstgeschichte |
| Laufzeit | 03/2023–06/2026 |
| Website und Kontakt | https://www.dhinfra.at/ |
| Fördergeber | BMBWF |
| Abstract | DHInfra.at baut eine Infrastruktur für digital gestützte Forschung in den österreichischen Geisteswissenschaften auf. Sie füllt die Lücke zwischen Standardangeboten in den Kulturerbeinstitutionen (Digitalisierung), im Forschungsdatenmanagement (kuratierte und integrierte Repositorien vs. institutionellen Repositorien), bei Softwarelösungen (fachspezifische Open Source-Produkte), und den High Performance Computing-Angeboten für die Natur-, Technik- und Lebenswissenschaften bei der Verarbeitung großer Datenmengen mit maschinellem Lernen. Es ist geplant, bedarfsgerecht Geräte zur Digitalisierung und Storage von Daten aus den Kulturerbeinstitutionen sowie Hardware für Forschung mit und produktiven Einsatz von Machine Learning-Verfahren zu beschaffen und zu implementieren. Open Source Software wird den spezifischen Bedürfnissen der Community angepasst und weiterentwickelt. Das existierende CLARIAH-AT-Konsortium erleichtert Governance und langfristige Pflege der Infrastruktur. Die in DiTAH begonnenen Maßnahmen zum Aufbau des DH-Helpdesk werden im Projekt weitergeführt. Darüber hinaus werden derzeit an den beteiligten Standorten Nutzungsszenarien und Kompetenzen in den fünf Feldern Data Capturing und Enhanced Images Sensing, Open Source Software, Datenmanagement und Repositorien, Infrastructure as a Service und Machine Learning erhoben, um den konkreten Bedarf an Hardware für die gemeinsame Infrastruktur zu bestimmen. Prof.in Dr.in Christina Antenhofer übernimmt für die PLUS die Leitung der Projektarbeiten. Dr.in Karoline Döring entwickelt und begleitet die laufende Bedarfserhebung. Die weiteren IZMF-Mitglieder Dr. Alan van Beek, Peter Färberböck, M.A., Julia Hintersteiner, M.A., Dr.in Isabella Nicka und Dr.in Lina Maria Zangerl erarbeiten aktuell gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Schäler von der DAS-Fakultät die verschiedenen Testszenarien für die an der PLUS angeschaffte Hardware. |